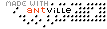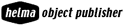Gastbeitrag 2 - Annett Gröschner
("Allein machen sie dich ein", der Song klingt mir immer noch im Ohr und ruft mich regelmäßig zurück aus meiner selbstgewählten Isolation in die Arme des Kollektivs. Warum immer alles alleine machen? Man muß delegieren können, sonst hätte Jesus nicht für uns sterben können. Deutschland steckt voller großartiger, hilfsbereiter Autoren. Heute habe ich mir einen Gastbeitrag von Annett Gröschner gewünscht, von der ich das Buch mit dem kompliziertesten Titel überhaupt gelesen habe: "ybottaprag. heute. geschenke. schupo. schimpfen. hetze. sprüche. demonstrativ. sex. DDRbürg. gthierkatt. Ausgewählte Essays" Kauft es euch, es enthält sehr kluge Essays und Artikel.)
Heiligabend zu Gast bei Jochen (virtuell) und in Magdeburg-Werder, Mittelstraße (ernsthaft) Lange Zeit hatte ich eine Armbanduhr, auf deren Ziffernblatt die ersten zwei Sätze aus Prousts "À la recherche du temps perdu" gedruckt waren: „Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire: ‘Je m’endors. ’ “ Da ich ständig und ganz profan auf der Suche nach der verlorenen Zeit bin, kam mir die Uhr gerade recht. Man sah damit auch wesentlich kulturbeflissener aus als mit der Geschenkabo-Uhr der Zeitschrift RUND, auf deren Zifferblatt sich die Zeiger um ein Stück Rasen drehen. Mit der Übersetzung ließen sich langweilige Minuten überbrücken. Irgendwie fehlte mir aber immer eine der bei Madame Scheibe im Französischunterricht der Humboldt-EOS gelernten Vokabeln, die sich aus meinem Gehirn verabschiedet hatte bzw. nie dort angekommen war. Auf den Gedanken, mal in der deutschen Ausgabe nachzusehen, bin ich nie gekommen. Leider legte sich die Uhr nach zehn Jahren die Angewohnheit zu, nur noch zu gehen, wenn sie sich an meinem Handgelenk befand. Sie blieb augenblicklich stehen, wenn ich sie ablegte. Jetzt ist sie im Ruhestand und hängt an der Erkerwand unter dem Hochwasserpanoramafoto des Magdeburger Werders, aufgenommen in der Minute, als das Hochwasser zum Stillstand kam und wir im Anschluss an die Aufnahme die Sachen meiner Schwester wieder aus dem Treppenhaus in die Hochparterrewohnung schleppen konnten. Und auf ebendieser Insel befinde ich mich gerade. Das Wasser der Elbe schleppt sich träge und ordentlich im Bett befindlich in Richtung Hamburg. Es ist so neblig, dass der Dom am anderen Ufer nicht zu sehen ist.
Fast jeder aus meiner Familie, der hier an meinem Computer vorbeigeht und beiläufig mitliest, fragt, ob ich schon „Little Miss Sunshine“ gesehen habe. Habe ich nicht. Das muss so eine Art Abschreckung für Leute sein, die sich ernsthaft mit Proust beschäftigen wollen. Man soll auf lange Dauer selbstmordgefährdet sein (was sich ja gestern irgendwie auch so halb bestätigt hat, hej Jochen, geht’s dir wieder besser?).
Ich muss keine Madeleine in meinen Tee tauchen, um mich zu erinnern, ich bin am Ort meiner Kindheit und Jugend, wie jedes Jahr Heiligabend (das spart den Weihnachtsbaum in der eigenen Wohnung). Hier falle ich, wo ich gehe und stehe über temps perdus und Erinnerungen an all die Marcels und Albertines und Saint Loups und watweeßickewennoch. Sie hießen damals aber Jens, Thomas, Simone oder Antje, während sich mein Sohn und seine Freunde nach Annas, Lenas, Ronjas, Saras oder Antonias verzehren, die heutzutage praktischerweise per SMS Schluss machen. Mich wundert, dass es neben JA und NEIN und ICH KOMME ERST UM... nicht schon die vorformulierte Antwort LASS UNS FREUNDE BLEIBEN in diesen Handys gibt.
Heute Nachmittag bin ich mit meinem Neffen Carl (9), der superschlau ist, aber noch an den Weihnachtsmann glaubt, mit der Linie 4 von einem Ende der Stadt zum anderen Ende gefahren, da lagen am Straßenrand und am Ufer der Elbe 136 Madeleines, 56 davon hatte ich schon in Texten verwendet. Ich gab ein paar zum besten, zum Beispiel die Geschichte von der aufgedunsenen Wasserleiche in der Alten Elbe, die wir beim Taubenfüttern auf dem Weg vom Hort nach Hause entdeckten und die, warum die Sandsteinputten der Anna-Ebert-Brücke alle, bis auf den Löwen, im Wasser der alten Elbe liegen, aber die erzähle ich jetzt nicht.
Eine Haltestelle weiter fiel mir auf, dass ich die seltsame und unwillkürliche Angewohnheit habe, Schauplätze fremder Bücher an Stellen zu verorten, die zu meinen persönlichen Erinnerungen gehören. Es fiel mir deswegen ein, weil ich auf dem Weg nach Cracau an der Karl-Marx-Schule vorbeikam, (heute heißt sie, folgerichtig, Immanuel Kant) und mir einfiel, dass ich immer, wenn ich Uwe Johnson lese, an diese Schule denke. Ja, ein Teil der Mecklenburger „Jahrestage“ spielte in meinem Kopf auf dem Schulhof der Karl-Marx-Schule. Armer Johnson – das Ensemble ist scheußlich. Es wurde in der Nazizeit aus roten Klinkersteinen in Anlehnung an die Burgen in Mitteldeutschland gebaut. In der Mitte ein abgesenkter Thingplatz. Hierhin wurden immer die Schüler meiner Schule strafversetzt, wenn sie Hakenkreuze in die Schulbänke geritzt hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in dieser Schule davon geheilt wurden.
Auf dem Rückweg fuhren wir mit der 4 über die Strombrücke. Das Bauwerk ist so alt wie ich und schon auf Dauer halbseitig gesperrt.
Wir hatten Zeit, denn wir durften erst wiederkommen, wenn der Weihnachtsmann weg war. Also machten wir noch einen Abstecher zur Endhaltestelle der 4 in Neu-Olvenstedt, wo sämtliche Jungs, die einstiegen, uniformiert waren: Glatze, Lonsdale, Springerstiefel. An der Wendeschleife standen Plattenbauruinen mit leeren Fensterhöhlen im diesigen Nebel. Die Bahn verschwand und kam so schnell nicht wieder. Carl sieht auf dem Video so traurig aus, als würde er auf den Kindernotdienst warten. Die Aufnahmezeit stand auf 1 h 08 min.
Mist, jetzt macht meine Schwester die Weihnachtsmusik an (Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage), das ist das Signal für die Bescherung und wir müssen uns dem Alter nach aufstellen und dürfen im Gänsemarsch ins Weihnachtszimmer. Meine Schwester singt und ist als Engel verkleidet. Ich bin die drittälteste, daran hat sich seit meiner Geburt nichts geändert, nur wurde die Schlange nach vorne immer länger. Ich stehe inzwischen ziemlich weit hinten und habe so noch Zeit für zwei Sätze:
Lieber Jochen: Frohe Weihnachten und lass Dir einen guten Rat von einer älteren Frau geben: Such nicht nach dem Meister, such nach Margarita!
In diesem Sinne
Annett
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Originalunterschrift gültig.
S. 119-129 Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich über den ersten Band der „Suche nach der verlorenen Zeit“ nicht hinausgekommen bin, obwohl ich doch „Der Mann ohne Eigenschaften“, die „Ästhetik des Widerstands“ und sogar „Ulysses“ geschafft habe. Ich habe „Combray“ angefangen, habe aber die Lektüre auf Seite 66 abgebrochen, dort steckt jedenfalls der Fahrschein, der als Lesezeichen diente. Einer aus einer Zahlbox der BVB, ist also fast 20 Jahre her, dass ich das Buch weggestellt habe. Ich denke, ich fand Marcel doch seltsam überspannt und voller Vorurteile in seiner eitlen Ich-Bezogenheit. Eigentlich sind immer die anderen schuld. Zum Beispiel Albertine. Man könnte sie ja mit heutigen Maßstäben für eine Metrosexuelle halten. Die Beziehung zu Marcel war ihr nicht genug, wahrscheinlich hat er die ganze Zeit nur über sich geredet, also hat sie sich eben zur Abwechslung noch mit Frauen vergnügt. Unter der Dusche. Allerdings ist eine einzige Zeugin dafür, die von Aimé bestochene Badefrau, doch ein wenig dürftig, aber Marcel nimmt ja jeden kleinen Strohhalm, um leiden zu können, obwohl er gleich am Anfang meint, dass er glaubte, dass seine Beziehungen und sein Vermögen es ihm erlassen würden zu leiden, „dieser Vorteil werde mich auch darum bringen zu fühlen, zu lieben und meine Phantasie zu betätigen; ich beneidete ein armes Mädchen vom Lande, dem das Fehlen aller Verbindungen und sogar eines Telegraphenbüros lange Monate des Träumens nach einem Kummer schenkt, den es nicht mit künstlichen Mitteln zu betäuben vermag.“ Danach folgt übrigens ein Satz, der das Herz jedes Grammatikers höherschlagen lässt: 16 Zeilen, ein Ungetüm aus Hauptstraßen und Nebenpfaden, dem Stadtplan einer mittelalterlichen Stadt mit Winkeln und Gassen gleich, wo man leicht die Orientierung verliert. Wahrscheinlich gibt es zig Doktorarbeiten allein über dieses Satzungetüm. Und das alles nur wegen dem oppositionellen, unbeugsamen Willen Albertines, über den kein Druck etwas vermocht hatte. Diese Empörung zwischen den Zeilen! Albertine, dieses untreue Wesen, die dann folgerichtig sterben muss und die, so glaubt der Held, jetzt noch leben würde, wenn sie Marcel nicht hintergangen hätte. Dabei hat der Gute sich selbst nicht entscheiden können zwischen den Gilbertes, Albertines, Andrées und all den Mademoiselles. Er hegt eine Verachtung für Frauen, die sich von ihm trennen, um dann doch wieder zurückzukehren und himmelt jene an, die ihn für immer verlassen. „Denn sehr oft ist, damit wir entdecken, dass wir verliebt sind, vielleicht sogar, damit wir es tatsächlich werden, erst einmal notwendig, dass der Tag der Trennung erscheint.“ (So oft ich mich an diesem Tag geärgert habe, dass ich ausgerechnet Heiligabend als Schreibtag vorgeschlagen habe, so muss ich doch sagen, es ist gut, Jochen, dass Du in Deinem Zustand das gerade nicht lesen musst. Du würdest sonst noch die Kunst mit der Realität verwechseln. „Aber bist du denn wahnsinnig? In was für neuen Vorstellungen lebst du, noch dazu unter so vielen Schmerzen? Alles das ist ja doch das wirkliche Leben nicht“, sagt der Verstand, bei Proust.) Marcels Rechnung war nicht aufgegangen, dass Albertine eine leichte Beute wäre. Gerade Albertine, die im Gegensatz zu Madame de Guermantes arm und unbekannt war und eher darauf bedacht gewesen sein musste, ihn zu heiraten, hatte sich ihm entzogen. Ganz klar, es geht hier um eine Niederlage unseres Helden, den dann aber neben seiner eifersüchtigen Raserei auch immer wieder lichte Augenblicke des Verstandes überwältigen: „Ob man nun gesellschaftliche Vorteile oder weise Voraussicht ins Treffen führen kann, Tatsache ist, dass man keine Macht über das Leben eines anderen Wesens hat.“ Albertine hat eben für sich in Anspruch genommen, genauso zu leben wie die Männer. Zur Strafe musste sie, da ist der Roman noch ganz 19. Jahrhundert, sterben wie Effi Briest und Anna Karenina, und zu allem Überfluss noch bei einem Reitunfall, diese böse Amazone, bevor sie, wie in der letzten Depesche angekündigt, zum Helden zurückzukehren konnte, reuig versteht sich. „Hätte sie wissen können, was geschehen würde, so wäre sie bei mir geblieben. Aber das würde heißen, dass sie, nachdem sie erst einmal ihren Tod erlebt hätte, doch lieber bei mir und lebendig gewesen wäre.“ Ja klar. Marcel hätte bald, siehe oben, das Interesse an ihr verloren.
Natürlich kreisen seine Gedanken immer wieder um die lesbische Liebe, der Albertine sich, nach Aussagen der Badefrau, regelmäßig und mit alt und jung hingab. Das wurmt Marcel mächtig, gibt er aber nicht zu. „Warum hatte sie mir nicht gesagt: Ich habe solche Neigungen’? Ich hätte nachgegeben, ich hätte ihr erlaubt, sie zu befriedigen, und würde sie noch in diesem Augenblick küssen.“ Albertine war schon ein kluges Mädchen, ihre Klappe zu halten. Der Held versucht, jede seiner und ihrer Regungen im Nachhinein zu analysieren und mit philosophischem Zuckerguss zu überziehen. „Vielleicht hätte sie, wenn sie es gewusst hätte, mit Rührung im Herzen gesehen, dass ihr Freund sie nicht vergaß, jetzt, da ihr Leben beendet war, und wäre vielleicht für Dinge empfänglich gewesen, die sie früher kaltgelassen hätten.“
Stattdessen muss der Held, wie ungerecht, sich Gedanken machen, ja er fühlt sich eigentlich von Albertine bestraft. Wenn er sie nämlich nicht mehr geliebt hätte, wäre sie für ihn schon gestorben, bevor sie tot war. So ist er gezwungen, ihrem Doppelleben nachzuschnüffeln. Liebeserlebnisse in einem Duschraum. Welche Verderbtheit. Unser Held wälzt sich dann noch ein paar Seiten in Eifersucht und Sexprotzereien. Siegerin nach Punkten bleibt Albertine, da kann sie tot sein, wie sie will.
Aimé, der dienstbare Geist, „der über gewisse Bildungsansätze verfügte“, wird auch noch entlarvt, indem Marcel seine Rechtschreibschwäche in einer Fußnote groß und breit auswälzt.
Ich denke, ich lese erst einmal Moby Dick zu Ende und dann den neuen Pynchon.
Unklares Inventar: Präzipitat.
Verlorene Praxis: Letzte Depeschen schicken.
Selbständig lebensfähige Sentenz: (schenke ich Dir, Jochen, zu Weihnachten, so als Sinnspruch in Sütterlin eingerahmt und unter Glas) "Man verlangt um so mehr nach einer Person, wenn sie dicht daran ist, sich uns hinzugeben; die Hoffnung nimmt den Besitz vorweg; die Sehnsucht wirkt als eine Verstärkung des Verlangens."
... Link
| Juli 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August | ||||||
Ein Aufenthalt in Bukarest hat mir Lust gemacht, wieder ein Blog zu beginnen....
Lange war es nur ein Blog, jetzt ist es endlich ein...
dem Proust? Liebe Blogleser, ich danke jedem einzelnen von Euch...
Zeit - Seite 427-447 (Schluß) - Was ham wirn heute...
Zeit - Seite 407-427 Eisiger Wind blies mir ins Gesicht,...
VII Die wiedergefundene Zeit - Seite 387-407 Warum hört man...
 Online for 8464 days
Online for 8464 days