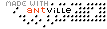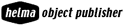Gastbeitrag 1 - Kathrin Passig
"Allein machen sie dich ein", der Song klingt mir immer noch im Ohr und ruft mich regelmäßig zurück aus meiner selbstgewählten Isolation in die Arme des Kollektivs. Warum immer alles alleine machen? Man muß delegieren können, sonst wäre Jesus nie für uns gestorben. Deutschland steckt voller großartiger, hilfsbereiter Autoren. Heute habe ich mir einen Gastbeitrag von Kathrin Passig gewünscht, und sie hat sich nach tausend Ausflüchten sofort einverstanden erklärt. Ich mußte ihr nur versprechen, ihr dafür ihr nächstes Buch zu schreiben, und das war es mir natürlich wert.
Berlin - IV Sodom und Gomorra - Seite 191-210 Schon frühmorgens fühle ich mich angesichts der Aufgabe, heute Jochen Schmidt zu sein, mutlos und überfordert. Ein guter Anfang, das geht dem echten Schmidt sicher genauso. Mit dem früh aufstehen fängt es schon an, denn anders als ich ist Schmidt ein disziplinierter Kulturschaffender; vermutlich folgt dann ein Tag voller Liegestütze und Empfindsamkeiten. Aber ich habe einen Startvorteil: Ich kann viel schneller lesen, als Schmidt, und daher das Proustpensum, für das er angeblich jeden Tag mehrere Stunden benötigt, in zehn Minuten bewältigen. Natürlich mache ich auch keine Anstreichungen, vielleicht ist mein Germanistikstudium deshalb so unbefriedigend verlaufen.
In der so eingesparten Zeit könnte man jetzt eigentlich doch noch ein paar Stunden schlafen, aber ich habe zu tun. Ich muss mich der Welt stellen und aufmerksam notieren, was mir Grund zum Missmut gibt. Angefangen bei dem Wasserfleck an der Decke, der sich zum Glück direkt über meinem Kopfkissen befindet. So kann ich die erste Kritik an der Welt bereits im liegen üben. Der Wasserfleck ist vor mehreren Monaten aufgetaucht, und er wird unleugbar größer. Außerdem schimmelt er, und ich frage mich jeden Morgen, ob die Schimmelsporen wohl unablässig auf mein Gesicht herabrieseln und mich im Schlaf vergiften. Wenn es so ist, bin ich verloren, denn die schwierigen Wasserfleckumstände machen eine Beseitigung des Problems unmöglich, jedenfalls für mich, und das selbst an den Tagen, an denen ich nicht Jochen Schmidt bin.
Ich sollte den Wasserfleck meinem Vermieter zeigen, was nicht geht, denn dazu müsste ich aufräumen und putzen. Bis dahin könnte ich wenigstens die schimmelnde Tapete entfernen, aber die lange Leiter steht im Büro. Ich kann die Leiter nicht nach Hause tragen, denn sie ist voll weißer Leimfarbe. Und angenommen, es gelänge mir, die Leiter in Kreuzberg zu waschen (was angesichts der sinkenden Tagestemperaturen immer unwahrscheinlicher wird) und sie nach Neukölln zu tragen, könnte ich sie nicht unter dem Fleck aufstellen, denn dort ist ja schon mein Kopfkissen. Das Kopfkissen gehört zu einem Wasserbett, und ein Wasserbett ist eine Immobilie. Eventuell müsste man zuerst das Wasser aus dem Wasserbett ablassen, was gar nicht schaden könnte, denn da ich viel zu selten daran denke, das vorgeschriebene Desinfektionsmittel hineinzugeben, ist das Bett mit einer trüben, rötlichen Algenbrühe gefüllt. Allerdings braucht man einen Schlauch und eine Pumpe, um das Wasserbett auszuleeren. Der Wasserfleck hat die Form von Frankreich. Bald wird er auch die Größe von Frankreich haben.
Ich beschließe, gar nicht erst aufzustehen. Meine derzeitige Lage, gesandwicht zwischen Schimmelpilzen und Algen, bietet die besten Voraussetzungen für eine künstlerisch fruchtbare Schwermut. Wenn ich die Dudenregeln 72, 82 und 112 konsequent mit Füßen trete, wird schon bald niemand mehr einen Unterschied zwischen mir und Jochen Schmidt feststellen können.
Seite 191-210 Die verschiedenen Salons werden ausführlich gegeneinander abgewägt. Lebe ich in so viel einfacheren Zeiten, oder entgehen mir nur im Unterschied zu Proust die Feinheiten des gesellschaftlichen Umgangs? Vielleicht sollte man viel weniger unüberlegt bei anderen erscheinen, man wird dadurch schließlich „selbst eine andere“. Attraktiv an den Salons: es gibt eine festgelegte Zeit, zu der die Gäste wieder gehen müssen: Madame Swann empfängt im Winter von sechs bis sieben Uhr.
Zu Madame de Montmorency geht Marcel offenbar nur wegen einer Statuette, dem großen feuchten, hallenden, echoerfüllten Treppenhaus, den mit Zinerarien gefüllten Vasen im Vorzimmer und dem Scheppern eines Glöckchens. Nur in einer Existenz des vollkommenen Müßiggangs kann man dem Scheppern der Glöckchen die Aufmerksamkeit widmen, die es verdient. Man sollte viel weniger arbeiten, der Meinung war auch Thoreau, der ganze Tage untätig auf seiner Türschwelle herumsaß: „There were times when I could not afford to sacrifice the bloom of the present moment to any work, whether of the head or hands.“ Vielleicht waren die diversen Revolutionsbestrebungen, die Reichen zur Arbeit anzuhalten, verfehlt, und man müsste sie stattdessen zu konsequentestem Müßiggang zwingen. Ich notiere das mal für die Zeit meiner kommenden Schreckensherrschaft über Deutschland.
Jetzt geht es wieder nach Balbec. Anscheinend sind seit dem letzten Aufenthalt zwei Jahre verstrichen, eins davon muss ich verpasst haben, und alles zurückblättern bleibt fruchtlos. Auf der Suche nach Prousts verlorener Zeit, eine neue Metaebene. Der Hoteldirektor überschlägt sich diesmal vor Zuvorkommenheit, aber „Je mehr neue Sprachen er lernte, desto schlechter sprach er die früheren“. Es folgen seitenweise Beispiele für die Fehler des Hoteldirektors, die einen besserwisserischen Beigeschmack haben, insbesondere dort, wo sie noch extra erläutert werden: „Er bringt uns wirklich zu sehr unter die Kutte (er meinte Knute) der Deutschen.“ Gehen wir zu Prousts Gunsten davon aus, dass hier nur der Erzähler in ein ungünstiges Licht gerückt werden soll.
Beim letzten Aufenthalt hatte Marcel in Balbec einen von Nebel durchwogten Ort gesucht, diesmal kehrt er zurück, weil er einen strahlend hellen Ort wiederfinden will, beides erweist sich als trügerisch: „Die Bilder, welche die Erinnerung auswählt, sind ebenso willkürlich, ebenso enggefaßt, ebenso ungreifbar wie die, welche die Einbildungskraft gestattet und die Wirklichkeit dann zerschlagen hat. Es besteht kein Grund, weshalb ein wirklicher Ort außerhalb von uns mehr Bilder der Erinnerung als des Traums in sich enthalten soll.“
Er ist unter anderem wieder dort, weil die Verdurins eines der cambremerschen Schlösser für den Sommer gemietet haben. Es ist immer unangenehm, nicht zu wissen, wie man Gelesenes aussprechen soll, und sei es nur in Gedanken. Was tun mit den cambremerschen Schlössern? Vielleicht einfach auf die klassische Kindertechnik zurückgreifen: bei der Erstlektüre von „Krieg der Knöpfe“ hießen meine Helden schließlich auch noch Lehbrack und La Krique. Für die schwere Handhabbarkeit der cambremerschen Schlösser entschädigt aber der Name der Mietsache: La Raspelière. Wenn in der Langnese-Entwicklungsabteilung jemand bei Trost wäre, hätten wir statt „Cremissimo“ und „Schmeckerfatz“ längst ein Eis dieses Namens.
Marcel hat rechtzeitig Erkundigungen eingezogen, ob die ebenfalls nach La Raspelière eingeladene Baronin Putbus ihre Jungfer mitzunehmen gedenkt: „Von da an war ich ruhig und zufrieden, dies Eisen im Feuer zu haben“, und das, obwohl „keine wesensmäßige Verbindung zwischen der Jungfer und der Region von Balbec“ besteht. Egal, denn in Balbec wird „das Gefühl für die Wirklichkeit dort nicht ... durch die Gewohnheit abgeschwächt sein“, anders, als in Paris, wo „die Lust in der Gesellschaft einer Frau“ ihm nicht „inmitten der alltäglichen Dinge die Illusion des Zugangs zu einem neuen Leben“ verschaffen kann. Aber warum eigentlich nicht? Um einmal vom Wechsel der Kommentatorenperspektive Gebrauch zu machen, möchte ich vermuten, dass Marcel sich nicht sehr für das interessiert, was innendrin ist in den Frauen, sondern eigentlich nur für ihre wesensmäßigen Verbindungen zu Regionen. Klar, dass es dann nicht klappt mit dem Zugang zum neuen Leben.
Aber alle Frauenangelegenheiten treten jetzt erst einmal in den Hintergrund, denn obwohl Marcel sich sehr langsam und vorsichtig bückt, um die Schuhe auszuziehen, wird er im selben Moment von einer „unwillkürlichen und vollständigen“ Erinnerung an seine Großmutter übermannt, die ihm vor etwa tausend Seiten am ersten Abend in Balbec die Stiefel aufgeknöpft hat. „Und so, in einem wahnsinnigen Verlangen, mich in ihre Arme zu stürzen, erfuhr ich erst jetzt, in diesem Augenblick, mehr als ein Jahr nach ihrer Beerdigung – auf Grund jenes Anachronismus, durch den so oft der Kalender der Tatsachen mit dem Kalender der Gefühle nicht zusammenfällt -, daß sie gestorben war.“
In der Folge wird ausführlich gelitten, das schlechte Gewissen über alles der Großmutter angetane quält ihn, aber auch dieses Leiden ist ein weitgehend selbstbezogenes: „... ich wollte nicht nur leiden, sondern auch die Originalität meines Leidens achten, so wie ich es plötzlich und unwillkürlich erlebt hatte, ich wollte es auch weiter erleben“. Er hofft, aus diesem „so schmerzlichen und im Augenblick unbegreiflichen Eindruck“ eines Tages ein wenig Wahrheit zu ziehen, und begeistert sich über den eigenartigen, spontanen Eindruck, „den nicht mein Verstand in mich eingezeichnet und mein Kleinmut abgeschwächt hatte“. Wäre das Buch fünfzig Jahre später entstanden, dürfte man für später mit Einblicken in ein höchst kompliziertes Sexualleben rechnen, voll vom Verstand eingezeichneter und vom Kleinmut abgeschwächter Eindrücke.
Es folgt ein langer Traum, in dem Marcel vergebens nach seiner Großmutter sucht, die „noch existierte, aber mit einem verminderten Leben, das blaß wie das der Erinnerung war“. Ich träumte kürzlich von Günter Grass und seiner SS-Mitgliedschaft. „Hoffentlich hat er sich nicht mit der Begründung zu entschuldigen versucht, es sei ja alles lange her“, dachte ich im Traum besorgt, „als Schriftsteller muss er doch wissen, dass alles gleichzeitig stattfindet.“ Aber wie Marcel, dessen Traum mit den Worten „Hirsch, Hirsch, Francis Jammes, Gabel“ endet, erging es auch mir: Schon war der Traum vorbei, „und wenn ich nun wiederholte: 'Francis Jammes, Hirsch, Hirsch', so bot mir die Folge dieser Worte nicht mehr den durchsichtigen Sinn und die Logik dar, die sie so natürlich für mich vor einer Sekunde noch gehabt hatten, an welche ich mich aber nicht mehr zu erinnern vermochte.“
Unklares Inventar – Schon wieder Zinerarien.
Verlorene Praxis: – Aus seinen Augenlidern ein paar Tropfen auf einen Topf mit Vergißmeinnicht fallen lassen.
Selbstständig lebensfähige Sentenz: – „Denn mit den Störungen des Gedächtnisses ist eine Intermittenz, ein Versagen auch des Herzens verbunden.“
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August | ||||||
Ein Aufenthalt in Bukarest hat mir Lust gemacht, wieder ein Blog zu beginnen....
Lange war es nur ein Blog, jetzt ist es endlich ein...
dem Proust? Liebe Blogleser, ich danke jedem einzelnen von Euch...
Zeit - Seite 427-447 (Schluß) - Was ham wirn heute...
Zeit - Seite 407-427 Eisiger Wind blies mir ins Gesicht,...
VII Die wiedergefundene Zeit - Seite 387-407 Warum hört man...
 Online for 8711 days
Online for 8711 days